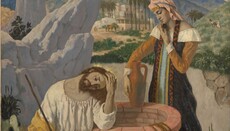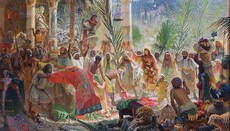Kiewer Variante des Kirchenslawischen: dafür und dagegen
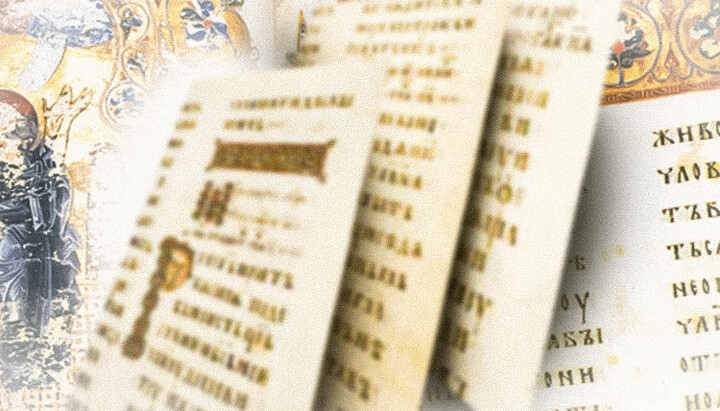
Heute wurde das Thema der Verwendung der Kiewer Ausgabe der Kirchenslawischen Sprache im Gottesdienst angesprochen. Was sind die Gründe und welche Konsequenzen könnte es haben?
Wahrscheinlich ist es allen kirchlichen Menschen klar, dass die altkirchenslawische Sprache, die heute im Gottesdienst verwendet wird, sich von der Sprache unterscheidet, die vor mehreren Hundert Jahren in Gebrauch war: als die Ukraine Teil des Großfürstentums Litauen und später der Polnisch-Litauischen Union war, und die Kiewer Metropolie Teil des Patriarchats von Konstantinopel war.
Früher interessierten sich diese sprachlichen Besonderheiten nur für Wissenschaftler und Linguisten, aber heute interessieren sich dafür ziemlich viele Menschen. Und nicht nur das. Einige fordern, die alte Kiewer Version der altkirchenslawischen Sprache in die moderne gottesdienstliche Praxis der UPT zu integrieren. Zum Beispiel veröffentlichte der Priester Jurij Petroljuk am 14. März 2025 auf der Ressource Dialog.tut einen recht ausführlichen Artikel mit dem Titel „Kiewer Version: Innovation oder Museumsexponat?“, in dem er dazu aufruft, diese Sprache im Gottesdienst so weit wie möglich zu verwenden.
Was ist die Kiewer Version?
Die Hauptmerkmale der Kiewer Version sind folgende:
- „Ukrainische“ Phonetik der Vokale. Zum Beispiel die Aussprache von „ы“ anstelle von „и“, „э“ anstelle von „е“ usw.
- Die „ukrainische“ Aussprache der altkirchenslawischen Sprache bestimmt die Betonung der Wörter gemäß den ukrainischen Akzentuierungsregeln. In Wörtern mit langen und kurzen Vokalen fällt die Betonung meist auf die vorletzte Silbe.
- Die „ukrainische“ Aussprache berücksichtigt die ukrainischen rhythmischen Besonderheiten und Intonation.
Die am weitesten verbreitete Meinung darüber, was die Kiewer Version der altkirchenslawischen Sprache ist und wie sie sich zur modernen altkirchenslawischen Sprache verhält, lautet wie folgt: Es handelt sich um die altkirchenslawische Sprache, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine bis zu ihrem Beitritt zum Russischen Kaiserreich und bis zum Beitritt der Kiewer Metropolie zur ROK verwendet wurde. Nach diesen Ereignissen verboten die russischen Kaiser die Verwendung der Kiewer Version, und stattdessen wurde die Moskauer Version gewaltsam eingeführt, die die Grundlage der modernen altkirchenslawischen Sprache bildet.
Diese Meinung ist nur teilweise richtig. In Wirklichkeit war alles etwas anders.
Tatsächlich war bis zur Eingliederung der Ukraine in das Russische Kaiserreich und der Kiewer Metropolie in die ROK auf dem Gebiet unseres Landes die sogenannte Kiewer Version der altkirchenslawischen Sprache in Gebrauch. Sehr vereinfacht kann man sich das so vorstellen: Ab dem 13.–14. Jahrhundert, als zwei politische Zentren entstanden, das Großfürstentum Litauen und das Großfürstentum Moskau, bildeten sich in diesen Zentren verschiedene Versionen der altkirchenslawischen Sprache, grob gesagt, die Kiewer und die Moskauer (es gab auch andere, aber das wollen wir nicht komplizieren). Dies geschah unter dem Einfluss sowohl lokaler sprachlicher Besonderheiten als auch des Bildungsniveaus der kirchlichen Schreiber, da in jener Zeit dieser Faktor eine große Rolle für die Richtigkeit der Sprache spielte, in der religiöse und gottesdienstliche Bücher geschrieben wurden. Im litauischen Fürstentum und später in der Polnisch-Litauischen Union war dieses Niveau deutlich höher, da die Kontakte unserer Schreiber mit griechischen und europäischen schriftlichen Quellen auf einem höheren Niveau waren.
Bis zum 17. Jahrhundert hatte sich in der Moskauer Rus eine beträchtliche Anzahl von Fehlern in gottesdienstlichen und lehrmäßigen Büchern angesammelt. Die Notwendigkeit, diese Bücher sowie die gottesdienstlichen Riten zu korrigieren, wurde von fast allen gebildeten Menschen jener Zeit erkannt. Die Frage war, nach welchen Quellen diese Bücher überprüft und Korrekturen vorgenommen werden sollten. Einerseits waren griechische und ukrainische Quellen zuverlässiger und korrekter, andererseits gab es in Moskau viele Menschen, die diesen Quellen nicht vertrauten.
Sie sagten, dass griechische Bücher durch den Einfluss der Muslime, die Konstantinopel und Kleinasien seit dem 15. Jahrhundert beherrschten, verderbt sein könnten, und ukrainische durch den Einfluss der Katholiken der Polnisch-Litauischen Union. Letztendlich entschied der Moskauer Patriarch Nikon die Frage mit Gewalt und führte die Reform hauptsächlich nach ukrainischen und teilweise griechischen Quellen durch. Seine Gegner verhärteten sich in ihrer Treue zu den alten Büchern, alten Riten und der alten Moskauer Version der altkirchenslawischen Sprache, trennten sich von der patriarchalischen Kirche und bildeten die bis heute bestehende Schismatische Gemeinschaft der Altgläubigen.
In der patriarchalischen Kirche, die 1686 die Kiewer Metropolie unter ihre Jurisdiktion nahm, entstand infolge der Nikon-Reformen und deren weiterer Fortsetzung die neu-altkirchenslawische Sprache, die sogenannte Synodale Version, deren Grundlage die Kiewer Version war, nach der hauptsächlich die Moskauer gottesdienstlichen Bücher korrigiert wurden. Gleichzeitig war der Einfluss der Moskauer Version ebenfalls spürbar.
Somit dominiert in der modernen altkirchenslawischen Sprache der Einfluss der Kiewer Version, während die alte vor-Nikon Moskauer Version nur bei den Altgläubigen erhalten bleibt. Dieser Einfluss ist nichts anderes als das intellektuelle und theologische Überlegenheitsgefühl (Wissenschaftlichkeit) der ukrainischen Kirchenvertreter gegenüber den Moskauer. In diesem Zusammenhang ist es logisch, auch die Tatsache zu erwähnen, dass nach dem Beitritt der Kiewer Metropolie zur ROK eine Massenbesetzung der Bischofssitze und der höchsten kirchlichen Ämter durch Personen aus der Ukraine stattfand, die als gebildeter und gelehrter galten. Eine Zeit lang wurden in der Russischen Kaiserreich praktisch alle Diözesen von ukrainischen Bischöfen geleitet.
Aber natürlich kann man auch nicht leugnen, dass Peter der Große 1720 das Drucken von Büchern und die Durchführung von Gottesdiensten in der altkirchenslawischen Sprache der Kiewer Version verbot.
Bewertungskriterien
Bei der Bewertung der Idee, die Kiewer Version in die moderne gottesdienstliche Praxis zurückzubringen, sollte man vor allem an Folgendes denken.
Erstens, der Gottesdienst ist in erster Linie ein Gebet. Und Gebet, so sind sich alle heiligen Väter einig, ist die Erhebung des Geistes und des Herzens zu Gott. Es geht nicht darum, ästhetisches Vergnügen an der Schönheit des Gottesdienstes zu empfinden, nicht um die Zufriedenheit, dass wir unsere uralte Sprache verwenden, nicht um die Deklaration unserer nationalen Eigenart, sondern um die Erhebung des Geistes und des Herzens zu Gott.
Zweitens, damit Geist und Herz zu Gott erhoben werden, muss die Sprache des Gottesdienstes für die betenden Menschen verständlich sein. Für die modernen betenden Menschen. Und das ist mehr als nur eine Modernisierung der gottesdienstlichen Sprache. Es ist der Ausdruck der erhabensten Begriffe über Gott, den Menschen, das Universum, die Erlösung in Worten, die für unser Verständnis zugänglich sind. Sehr oft können diese Konzepte in modernen Sprachen einfach nicht ausgedrückt werden, und solche Versuche führen oft zu einer Verarmung der Bedeutungen und manchmal sogar zu deren Verzerrung.
Um die Sprache verständlich zu machen, kann man nicht einfach das Gottesdienst von der altkirchenslawischen Sprache ins Ukrainische oder in andere Sprachen übersetzen. Produktiver in dieser Hinsicht ist nicht die Modernisierung des Gottesdienstes, sondern die eigenen geistigen und intellektuellen Anstrengungen des Menschen, die auf das Verständnis des altkirchenslawischen Gottesdienstes gerichtet sind. Obwohl natürlich auch die Einführung einzelner Änderungen in die altkirchenslawischen Texte manchmal notwendig ist.
Und drittens, die gottesdienstliche Sprache sollte der Einheit der Gläubigen dienen und nicht deren Differenzierung.
Argumente für die Einführung der Kiewer Version
Die Argumente der Befürworter der Verwendung der Kiewer Version lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen.
Erstens, die Position der ROK im Krieg der RF gegen die Ukraine, die, gelinde gesagt, sehr weit vom Evangelium entfernt ist, weckt den Wunsch, sich nicht nur von dieser Position, sondern auch von allem, was mit Moskau zu tun hat, zu distanzieren. Und unter dem heißen Wunsch könnte durchaus die altkirchenslawische Sprache, die derzeit in der gottesdienstlichen Praxis verwendet wird, leiden.
Zweitens, das Bestreben, sich vor den Feinden der UPT zu rechtfertigen